|
|
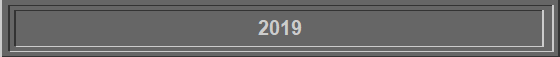 |
|
|
Zitate von Peter Scholl-Latour
Scholl-Latour ist der bedeutendste deutsch (-französische) politische Journalist & Schriftsteller der Jahrzehnte seit 1940. Er ist 1924 geboren und 2014 als 90jähriger verstorben. Er hat etliche Bücher verfasst, die jeweils sehr viel interessante Informationen über diverse Länder, Personen und historische Hintergründe enthalten. Ihm war es wichtig, an möglichst vielen Brennpunkten der Welt seine Recherchen an vorderster Front des Geschehens zu unternehmen. Deshalb sind seine Aussagen sehr authentisch und auch auf Stichhaltigkeit geprüft. - Ich werde hier aus seinen diversen Büchern einige Zitate bringen, die das eben Gesagte verdeutlichen sollen. Aus dem Buch: Der Fluch des neuen Jahrtausends. Eine Bilanz, ab 2002 Bertelsmann München, S. 316f. Bericht vom 2. Juli 2001 über Südafrika. <In der Republik Südafrika sind im Jahr 2001 etwa 9 Millionen oder 20 Prozent der Bevölkerung HIV positiv, und täglich werden 200 infizierte Babies geboren. (...) Zutiefst verwirrend war die Reaktion des Staatspräsidenten Südafrikas, Thabo Mbeki, des Nachfolgers von Nelson Mandela. Dieser an englischen Universitäten geschulte Ökonom, dem man gelegentlich vorwirft, er sei zu verwestlicht, hat sich als authentischer Sohn seines Kontinents erwiesen. Mbeki weigerte sich, einen Zusammenhang zwischen HIV-Infektion und Aids-Erkrankung herzustellen. Trotz der Proteste der Ärzte machte er das angeblich vom weißen Kolonialismus verursachte Elend seiner Landsleute für den Ausbruch der Seuche verantwortlich. Er kann es einfach nicht ertragen, daß sein Erdteil als Ausgangspunkt für Aids herhalten muß und die sexuelle Promiskuität der Bantu-Stämme das Ausmaß des Unheils ins Unermeßliche gesteigert haben soll. Der starke Geschlechtstrieb der Afrikaner, auf den sie stolz sind und der auch von den schwarzenn Frauen als Test der Männlichkeit gefordert wird, nimmt oft kultische Formen an.> <Die Heilkunst der westlichen Medizin gilt nicht viel beim einfachen Volk. Da vertraut man lieber dem düsteren Ritual der ‘Munganga’, des Medizinmannes. Geschlechtsverkehr mit einer Jungfrau biete Schutz und Immunität gegen Aids, so sagen die Zauberer. Die Zahl von Vergewaltigungen junger Mädchen, ja von weiblichen Babys ist seitdem auf gräßliche Weise angestiegen. Soldaten, Lastwagenfahrer und Lehrer, die sich an ihren Schülerinnen vergehen, werden neben Wanderarbeitern als Hauptverursacher der Seuche genannt.> Aus dem Kapitel: Aids in Afrika: Massensterben ohne Grenzen ______________________________
Aus dem Buch: Leben mit Frankreich. Stationen eines halben Jahrhunderts. DVA Stuttgart 1988, S.139 ff.
Über Verdun
(Foto von Julian Nyca - siehe Wikimedia)
Sie waren fast alle über siebzig Jahre alt, die Greise, die auf der voie sacreé [Heilige Straße: ist eine Straße in Frankreich von Bar-le-Duc nach Verdun. Sie stellte während der Schlacht um Verdun die Hauptverkehrsader für den Nachschub des Französischen Heeres dar. Wikipedia] der Erinnerung nach Verdun gekommen waren. Sie waren den Stahlgewittern des Krieges, in denen die Blüte ihrer Generation gefallen war, entkommen. Aber jetzt standen auch sie unwiderruflich am Rande des Grabes. Das halbe Jahrhundert, das ihnen das Los der Schlacht zusätzlich zu leben gewährt hatte, erschien ihnen rückblickend als eine knappe Gnadenfrist. Der Abend über Douaumont [Das Beinhaus von Douaumont (franz. Ossuaire de Douaumont)] war klar und kalt. Wie der weiße Arm eines Skeletts tastete der Scheinwerfer vom Turm des Beinhauses die Friedhöfe ab. Die alten Männer fröstelten auf den eisernen Stühlen, die man ihnen zugewiesen hatte. Eben hatten sie noch gelärmt, während sie ihre Quartiere in den Kasernen von Verdun bezogen, wo die Rekruten von heute jedes Bett mit einem Strauß Feldblumen geschmückt hatten. Dann waren sie im Autobus auf die tragische Höhe von Fleury [Fleury-devant-Douaumont war bis zum Beginn der Schlacht um Verdun im Ersten Weltkrieg ein kleines französisches Bauerndorf im Département Meuse in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen). Es lag im inneren Verteidigungsring Verduns und in strategisch entscheidender Lage vor Verdun zwischen dem Fort de Souville und der Ouvrage de Froideterre. Wikipedia] und Douaumont gefahren. Sie faßten noch einmal aus der Feldküche einen Schlag Essen und tranken den gros rouge, den Rotwein, der zur unentbehrlichen Tagesration des poilu [= der Tapfere, Unerschrockene] von 1914 gehört hatte. Sie waren sich einen Moment lang wie Mordskerle vorgekommen, daß sie dem Tod so lange ein Schnippchen geschlagen hatten. Ein paar von ihnen hatten unter dem gerührten Blick der Kriegerwitwen das Lied vom fröhlichen Mädchen Madelon angestimmt. Jetzt saßen die Veteranen vor der sinkenden Sonne, die die zerstörten Kasematten des Fort de Vaux noch einmal wie mit roter Feuersbrunst erhellte. Die Kälte der einbrechenden Nacht kroch ihnen allmählich in die müden, gichtigen Knochen wie ein kühler Vorbote des Todes. Die meisten trugen die Baskenmütze verwegen auf dem gelichteten grauen Haar. Ihre Orden hingen in vierfacher Reihe an den von der Reise zerknitterten Jacken. Viele stützten sich auf Stöcke. Der eine oder andere trug einen verbeulten Helm oder den roten Fes der Zuaven [Der Begriff Zuave wurde für in Nordafrika rekrutierte Söldner gebraucht. Die Zuaven trugen auffällige, an türkisch-orientalische Trachten angelehnte Uniformen. Wikipedia]. Fast jeder hatte seinen alten Brotbeutel über die Jahre gerettet, von besorgten Anverwandten vor der Abreise mit Proviant gefüllt. Das Alter hatte die sozialen Schichten verwischt. Vorherrschend waren die gedrungenen, bäuerlichen Typen mit rauhem Akzent, weingeröteten Gesichtern und knorrigen Gliedern. Die Alten musterten all jene, die nicht zu den Jahrgängen der Schlacht von Verdun gehörten, wie Eindringlinge und blickten mit einer gewissen feindseligen Herablassung auf die Jüngeren. Sie hatten damals standgehalten, hatten das Wort Pétains „On ne passe pas“ [Sie werden nicht durchkommen] wahrgemacht, waren ohne Aufmucken zur Schlachtbank am Toten Mann [Höhe Mort Homme] hinaufgezogen. Ihre Nachfolger von 1940 hingegen hatten ihr Erbe verwirtschaftet, und der neuesten Generation mit den langen Haaren und der wüsten Musik trauten sie auch nicht viel zu. Les anciens [die ehemaligen Kämpfer] waren die letzten Zeugen dafür, daß Frankreich eine große kriegerische Nation war, ehe dieses glänzende Geschichtsbild durch die Niederlage von 1940 getrübt wurde. Dumpfe Trommelwirbel leiteten die Feier ein. Der Mond schien auf die Parade der Kreuze. Zwischen den Gräbern waren die Traditionsfahnen wie ein flatternder Wald angetreten, den die Scheinwerfer blau-weiß-rot umspielten. Vier alte Männer bewegten sich mühsam – zwei davon über Krückstöcke gebeugt – auf einen Katafalk zu, um dort die Flamme zu entzünden. Die clairons [Signalhörner] bliesen zur Totenehrung. Am Eingang des Mausoleums, vor dem runden Tor, das zu den Gebeinen von dreihundertausend französischen und deutschen Soldaten führt und über dem in goldenen Lettern „Pax“ steht, salutierte General de Gaulle, eine riesige graue Gestalt zwischen den vom Alter geknickten Veteranen. Aus den Lautsprechern dröhnten Musik und die Stimmen von Schauspielern, die den Ablauf der Schlacht schilderten und Auszüge aus Werken von Henri de Montherland und Jules Romains über diese größte kriegerische Begegnung der Geschichte verlasen. Bengalische Feuer loderten wie riesige Brände über den heiß umstrittenen Höhen. (…) Zwischen den Gräbern waren Tausende von Fackeln aufgeflammt. Ergriffenheit hatte sich aller Anwesenden bemächtigt. Die Veteranen blickten mit leeren, tränenden Augen auf das Schauspiel und sahen über die Lichter hinweg, deren Qualm die Traditionsfahnen wie Pulverdampf einhüllte, zu jenen Höhen hinauf, wo sechshunderttausend Menschen ihr Leben gelassen hatten und wo die Vegetation bis auf den heutigen Tag durch den Einschlag von fünfzig Millionen Granaten verkrüppelt bleibt. Die Greise klammerten sich an die Schäfte ihrer Fahnen; sie trugen sie längst nicht mehr, sie stützten sich auf sie. (…) Am Morgen des Pfingstsonntags zelebrierte der Erzbischof von Auch, ein ehemaliger Frontkämpfer von Verdun, am Eingang des Beinhauses das Seelenamt. Der Altar war mit einem Seidentuch bespannt, auf dem das croix de guerre, der französische Tapferkeitsorden, abgebildet war. Kardinal Feltin, Erzbischof von Paris, ebenfalls ein Veteran von Douaumont, erinnerte mit tränenerstickter Stimme an das Opfer der Hunderttausende. Wieder einmal waren katholische Kirche und französische Nation zu einer mystischen Einheit zusammengewachsen, so wie es der Dichter Charles Péguy gesehen hatte, der 1914 an der Marne fiel. Feltin erinnerte an das entscheidende Verdienst des Generals Philippe Pétain und gab damit das Stichwort für Charles de Gaulle. Charles de Gaulle war nicht nur nach Verdun gekommen, um die gloire von 1916 zu zelebrieren. Der General wollte auch versuchen, die Schmach des Jahres 1940 zu löschen. Ein Name war symbolisch für den erfolgreichen Widerstand Frankreichs im Ersten und die glanzlose französische Niederlage im Zweiten Weltkrieg: der Name des Marschalls Philippe Pétain. De Gaulle und Pétain verkörperten gemeinsam die Tragödie der jüngsten französischen Geschichte. Unter dem Befehl Pétains hatte der Hauptmann de Gaulle auf den Höhen von Verdun gekämpft, ehe er – zum dritten Mal verwundet – in deutsche Gefangenschaft geriet. Nach dem Krieg hatte der Marschall bekanntlich die Karriere des jungen und begabten Stabsoffiziers de Gaulle gefördert, bis sie sich zerstritten. Der Zank mit Pétain artete in schicksalhafte Gegnerschaft aus, als der Marschall nach der Besetzung Nordfrankreichs durch die Deutschen in Vichy den „Etat Francais“ errichtete und die Kollaboration guthieß, während der unbekannte Brigadegeneral de Gaulle von London aus zum Widerstand aufrief. Beide Männer waren gezwungen, sich gegenseitig im Namen des Vaterlandes zum Tode zu verurteilen. Erst unlängst erfuhr man, daß de Gaulle nach seiner Regierungsübernahme in Paris im Sommer 1944 dem Marschall raten ließ, seinen Lebensabend im Schweizer Exil zu beschließen, statt sich der rachsüchtigen französischen Justiz von 1945 zu stellen. Während der Gerichtsverhandlung gegen den „Chef de L’Etat Francais“ hatte de Gaulle den Geschworenen durch einen Mittelsmann nahegelegt, den Marschall nur zu fünf Jahren Verbannung zu verurteilen. Falls de Gaulle damals an der Macht geblieben wäre, hätte er auf keinen Fall den alten verdienstvollen Mann in der modrigen Festung auf der Ile d’Yeu als Häftling sterben lassen. Pétain und de Gaulle verkörperten zwei scheinbar unversöhnliche Gesichter der französischen Geschichte. Aber de Gaulle wäre der monarchischen Tradition Frankreichs untreu geworden, hätte er nicht versucht, auch über die Spaltungen der jüngsten Vergangenheit den Mantel der nationalen Union zu breiten. Mit Rücksicht auf seine eigene Überzeugung und auf einen Teil des französischen Volkes, der sich heute noch mit der Résistance identifiziert, konnte er die von vielen Veteranen geforderte Überführung der Leiche des Marschalls nach Douaumont nicht gutheißen. Doch in seiner Rede am Totenmal, die wie eine meisterhafter Vortrag in der Kriegsschule begann, zollte de Gaulle dem siegreichen Feldherrn von Verdun höchstes nationales Lob. Mochte zur gleichen Stunde auf der Insel Yeu, wo Pétain seine vorläufige Ruhestätte gefunden hat, ein Trüpplein von Unentwegten das alte Lied seiner Anhänger der Vichy-Zeit „Maréchal, nous voilà“ [Hier sind wir, Marschall] – in den Wind des Atlantiks singen; hier in Douaumont versöhnte de Gaulle mit der breiten V-Geste seiner ausgestreckten Arme das revoltierende Freie Frankreich von 1940 mit den Pétain-treuen Frontkämpfern von 1916. Hier wurde die Legende der nationalen Einheit Frankreichs neu geschmiedet, auch wenn die exakte Historie dabei ein wenig zu kurz kam. Von diesem Tag der Pfingstfeier in Verdun an würde der greise Marschall in die Überlieferung eingehen als der Schild Frankreichs, als der greise Mann, der in den schlimmen Jahren 1940 bis 1944 seinen Ruhm dem Überleben der Nation opferte und im demütigenden Gespräch mit Hitler auf dem Bahnhof von Montoire verhinderte, daß Frankreich von einem Gauleiter des „Führers“, von einem Quisling oder gar als Generalgouvernement verwaltet wurde. Ergänzten sich nicht diese beiden Gestalten, Pétain als Schild und de Gaulle als Schwert der Nation, de Gaulle, der, außerhalb des Mutterlandes kämpfend, dafür gesorgt hatte, daß Frankreich 1945 wieder auf der Liste der Sieger stand? Pétain und de Gaulle, sie bildeten von nun an ein feierliches Diptychon auf dem Altar des Vaterlandes. Die Veteranen hatten die Huldigung an den Marschall Pétain mit Beifall aufgenommen. De Gaulle leitete den letzten Teil seiner Ansprache ein. Er wandte sich an die Deutschen: Nicht an die paar deutschen Touristen in Verdun, die in hellen Hosen und Dirndlkleidern über den Rhein gereist waren, und auch nicht an jenen isolierten deutschen Frontsoldaten von Douaumont, der ganz allein – aus Ludwigsburg kommend – bis in die späte Nacht durch die leeren Straßen von Verdun auf der Suche nach einem Quartier geirrt war, bis ihn ein französischer Feldwebel brüderlich am Arm genommen und ihn in seiner Kaserne in eine Stube voll junger Rekruten geführt hatte, wo man den alten Mann bei Rotwein und Bier von seinen Fronterlebnissen des Jahres 1916 erzählen ließ. (…) „Franzosen und Deutsche“, rief de Gaulle über die Friedhöfe, „haben hier den Gipfel ihres Ruhms erreicht, aber sie mußten erkennen, dass die Frucht dieser gewaltigen Anstrengungen am Ende nur Leiden war.“ Er forderte die Deutschen auf, jenen Vertrag des Jahres 1963 nicht verdorren zu lassen [Élysée-Vertrag], der die Zusammenarbeit Frankreichs mit Deutschland als „unmittelbarem und privilegiertem“ Partner bekräftigen sollte. „Unmittelbar und privilegiert“, so hieß das Angebot damals, als die Bahn noch in Richtung auf eine deutsch-französische Nation der Zukunft offenzustehen schien. An dieser historischen Stätte von Verdun, erinnerte de Gaulle, habe sich vor tausendeinhundertdreiundzwanzig Jahren das Reich Karls des Großen gespalten, die getrennte Geschichte Deutschlands und Frankreichs ihren Ausgang genommen.
(Aus dem Kapitel: “Gipfel des Ruhms”) _______________________________________________
Aus dem Buch: Aufruhr in der Kasbah. Krisenherd Algerien. Heyne Verlag München 1994, S. 41f. “In mancher Beziehung”, fuhr mein alter Freund fort, “erinnert mich die Situation an die frühen fünfziger Jahre.” Damals sei es den Franzosen gelungen, die breite nationalistische und islamische Volksbewegung des bärtigen Tribuns Messali Hadj, die sich einmal unter dem Namen <Algerische Nationalbewegung> MNA, dann als <Bewegung für den Triumph der demokratischen Freiheit> MTDL präsentierte, zu unterwandern, zu spalten, ja zu diskreditieren. Die Kolonialherren hätten sich etwas darauf eingebildet, dem stürmischen Vorläufer Messali Hadj, der wie ein orthodoxer Pope wirkte, das Wasser abgegraben zu haben, bevor sie ihn in die Bretagne verbannten. “Aber 1954, am Allerheiligentag”, fuhr er fort, “kam das schreckliche Erwachen. Plötzlich hatte man es nicht mehr mit einer öffentlich zugelasssenen Partei zu tun, die man nach Belieben schikanieren und infiltrieren konnte, sondern es war die militärische Geheimorganisation O.S. entstanden. Auf einmal tappten die Beamten der Sûreté und die Offiziere des Deuxième Bureau im dunkeln.”
(Aus dem Kapitel <Die neuen Mamelucken>)
|
|
