|
|
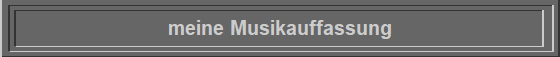 |
|
|
08.10.08
Meine melodiemäßige Musikauffassung - mit der ich übrigens mit der sehr musikinteressierten Barbara zu mindestens 95% einig bin - und zwar schon seit unserem Kennenlernen. Ich lese jetzt gerade „Doktor Faustus“ von Thomas Mann. Es ist ein Gelehrten- und Künstlerroman auf hohem Niveau. Wenn man mit dem Niveau was anfangen kann, ist das Buch sogar richtiggehend spannend. Es geht um den Lebensweg eines im schulischen Sinne besonders intelligenten Mannes (“Adrian Leverkühn”), dem es aber, wie er sogar selber bekundet, in emotionaler Hinsicht an Wärme fehlt. Der glaubt nun zum Musik-Komponisten berufen zu sein. Ich habe das Buch jetzt zu ungefähr 1/3 durch. Doch zeichnen sich hier schon ein paar interessante Gedankengänge ab, die auch für mich selber hoch relevant sind.
Vor allem dieser Gegensatz zwischen melodischer, “tonaler” Musikauffassung und sogenannter vergeistigter Musikauffassung.. Thomas Mann fädelt das Ganze natürlich wieder sehr geschickt ein. Z.B. läßt er einen Kantor der Kleinstadt, in welchem Adrian Leverkühn ins Gymnasium geht, gelehrte Vorträge über esoterische Musikthemen halten. Etwa über die Frage, ob Beethoven die Kunst der Fuge beherrscht habe (S. 79 ff.). Beethoven konnte einen höfischen Auftrag (die Missa Solemnis) nicht fristgerecht erfüllen, weil er an dem Problem verzweifelte. Aber es war offenbar in Offizialkreisen des 19. Jahrhunderts Konsens, daß ein richtiger, ernstzunehmender Komponist sich durch die Beherrschung der Kunst der Fuge auszeichnete. Beethoven galt also demgemäß als Stümper!
Das erinnert mich an meine letzte Session mit Diedrich, einem bildungsbürgerlichen Pfarrer im Ruhestand. Wir trafen uns in unserem gemütlichen winterlichen Partykeller bei einem prasselnden Kaminofen und ich hatte ihm zu Ehren von Bach eine CD aufgelegt: „Kunst der Fuge“. Ich kannte diese Musik vorher nicht. Ich wollte sie nun endlich mal gerne kennenlernen. Bach hat unfaßbar schöne Musik gemacht, wenn ich z.B. an Air (BWV 1070) und an manches sonstiges denke. Deshalb hatte ich Vertrauen zu ihm. Doch diese Kunst der Fuge war für mich der wahre Gräuel. Ich konnte dieser Musik überhaupt nichts abgewinnen. Diedrich war dieser Musik gegenüber keineswegs kritisch, sondern erklärte mir nur wissend, man müsse dabei gleichzeitig die Geigenvirtuosin Anne-Sophie Mutter sehen, dann habe man das richtige Erlebnis. Ich ließ dann diese schreckliche 'Musik', bei der sich mir alles sträubte, eine Zeitlang weiterlaufen, einfach auch, um der Sache noch mal eine Chance zu geben. Aber nachdem sie mich genug gequält hatte, legte ich Händels „Messias“ auf, um endlich wieder Wohlklang und Gefühl erleben zu dürfen.
Da mich das Ganze nun genug genervt hatte, legte ich mit einer eigenen Musiktheorie los, denn ich hatte schon von früher her, bei Tischgesprächen mit Rudi, einige Musikdiskussionen hinter mir. Diese meine Musikauffassung sieht nun ungefähr so aus: Es gäbe ein Abwehr gegenüber wirklich authentischer, gefühlvoller Musik, indem die Leute z.B. unbedingt Chopin oder generell Mozart gut fänden. Oder eben beispielsweise die Kunst der Fuge von Bach oder Quartette von Beethoven, 12-Ton-Musik, usw. Das Gleiche fände auf der Pop- und Rock-Ebene ebenfalls statt in Form von Hard-Rock, Brainkiller-Musik, südamerikanischen Rhythmen, Ami-Schreppen, Reggae, Rap, Techno, Jazz usw.
Durch Thomas Mann lernte ich nun, daß diese meine Vorstellung die “tonale”, also eine melodische und gleichzeitig ‘altmodische’ Musikauffassung“ sei. Denn der Gegensatz dazu sei eine „aus dem bloß Musikalischen ins allgemein Geistige hinaustretende Kunst“. (S.191)
Die Musik soll also das „bloß Musikalische“ verlassen!
Na gut. Ich persönlich stehe jedoch dazu, daß ich beim „bloß Musikalischen“ bleibe, wenn ich Musik hören will. Außerdem stehe ich solcherlei Ansichten ziemlich skeptisch gegenüber. Leverkühn gibt eine ‘intelligente’, abwertende Typologie der Melodie (S. 178 f.):
<So geht es zu, wenn es schön ist: Die Celli intonieren allein, ein schwermütig sinnendes Thema, das nach dem Unsinn der Welt, dem Wozu all des Hetzens und Treibens und Jagens und einander Plagens bieder-philosophisch und höchst ausdrucksvoll fragt. Die Streicher verbreiten sich eine Weile weise kopfschüttelnd und bedauernd über dieses Rätsel, und an einem bestimmten Punkt ihrer Rede, einem wohl erwogenen, setzt ausholend, mit einem tiefen Eratmen, das die Schultern emporzieht und sinken läßt, der Bläserchor ein zu einer Choral-Hymne, ergreifend feierlich, prächtig harmonisiert und vorgetragen mit aller gestopften Würde und mild gebändigten Kraft des Blechs. So dringt die sonore Melodie bis in die Nähe eines Höhepunkts vor, den sie aber, dem Gesetz der Ökonomie gemäß, fürs erste noch vermeidet; sie weicht aus vor ihm, spart ihn aus, spart ihn auf, sinkt ab, bleibt sehr schön auch so, tritt aber zurück und macht einem anderen Gegenstande Platz, einem liedhaft-simplen, scherzhaft-gravitätisch-volkstümlichen, scheinbar derb von Natur, der's aber hinter den Ohren hat und sich, bei einiger Ausgepichtheit in den Künsten der orchestralen Analyse und Umfärbung, als erstaunlich deutungs- und sublimierungsfähig erweist. Mit dem Liedchen wird nun eine Weile klug und lieblich gewirtschaftet, es wird zerlegt, im einzelnen betrachtet und abgewandelt, eine reizende Figur daraus wird aus mittleren Klanglagen in die zauberischsten Höhen der Geigen- und Flötensphäre hinaufgeführt, wiegt sich dort oben ein wenig noch, und wie es am schmeichelhaftesten darum steht, nun, da nimmt wieder das milde Blech, die Choral-Hymne von vorhin das Wort an sich, tritt in den Vordergrund, fängt nicht gerade, ausholend wie das erste Mal, von vorne an, sondern tut, als sei ihre Melodie schon eine Weile wieder dabei gewesen, und setzt sich weihesam fort gegen jenen Höhepunkt hin, dessen sie sich das erste Mal weislich enthielt, damit die Ah!-Wirkung, die Gefühlsschwellung desto größer sei, jetzt, wo sie in rückhaltlosem, von harmonischen Durchgangstönen der Baßtuba wuchtig gestütztem Aufsteigen ihn glorreich beschreitet, um sich dann, gleichsam mit würdiger Genugtuung auf das Vollbrachte zurückblickend, ehrsam zu Ende zu singen.>
Es kann ja sein, daß Leverkühn (als Vertreter jener Gefühlskälte bzw. Gefühlsabwehr in der Musik) hier was Wahres bezüglich der Logik der Melodie erkannt hat. Doch schließen sich da für mich sofort drei Fragen an:
1.Besteht nicht ein natürliches, gewissermaßen biologisches Bedürfnis nach solch einer Abfolge? (Man denke zum Beispiel an die Kunst des wohlschmeckenden Essens oder an die Kunst des gelungenen Orgasmus). Ist das Erkennen jener Abfolge im Bereich der Töne nicht selber eine hohe geistige Leistung? Ich denke, nicht alle Völker und Kulturen haben das geschafft. Beispielsweise die slawischen Völker unbedingt, aber nur in Ausnahmefällen die arabischen und mitteleuropäischen. 2.Es ist doch keine Selbstverständlichkeit, eine gute Melodie zu verfassen! Dazu gehören besondere, einmalige Lebenssituationen, eingebettet in kulturelle Situationen des Künstlers, die später nie wiederholbar sind. Dahinter stecken einmalige geschichtliche Situationen – ganz analog zur Architektur oder zur konkreten Malerei. - Leverkühn tut gerade so, als ob die “Vier Jahreszeiten” von Vivaldi oder die 9 Sinfonien von Beethoven jederzeit neu erfunden werden könnten. Da irrt er sich meiner Ansicht nach gewaltig. Soll er doch mal versuchen, eine analoge 5. Jahreszeit oder eine 10. Sinfonie zu komponieren, die ebenso ergreifend ist. Er würde sich in der Tat unsterblich machen. 3.Wie will er eigentlich den Unterschied herausarbeiten zwischen Mistzeug & Dreck in der Musik und gelungenen Sachen, wenn es nicht um Gefühl und Melodie geht? Da kann doch jeder Hardrocker, Jazzmusiker, südamerikanische Rhythmer, jede nordamerikanische Schreppe, jeder beliebige Kitsch- oder 12-Töner, irgendein Mahler, Paganini, Rapper oder Brainkiller daherkommen und sagen: Ej, hier das ist (hochgeistige) Musik! Da habt ihr den Hut vor ab zu ziehen! (Was ja dann in der Tat eine Menge Leute auch tun).
Ich hab da noch so ne andere Theorie, die mir im Laufe des Buches von Th. Mann gekommen ist. Wir in Deutschland verstehen unter ernster 'Musik' traditionellerweise eigentlich nur diese höfische oder klerikale Musik seit dem Mittelalter und schließlich die klassische (höfische) Musik. Dann gibt es die unernste U-Musik, unter der Volksmusik, Wanderlieder, Gassenhauer, Schlager, Pop-Musik, Jazz u.dergl. eingereiht wird. Die Bildungsbürger bilden sich üblicherweise ein, das sei die Musik-Entwicklung, hiermit sei alles erfaßt, und was anderes an Schematisierung gibt es nicht. - Allein schon die folgende Tatsache widerlegt das aber, nämlich daß es sowas wie ernsthafte und hochgradig entwickelte, gefühlsmäßig vollkommene Volksmusik gibt, wie das beispielsweise in slawischen Ländern und auf dem Balkan, aber auch z.B. (früher) in Griechenland und in Italien restmäßig noch der Fall – wenn auch leider am Verkümmern – ist.
Aber auch was sich im nordamerikanischen Raum an differenzierter Musiktradition gebildet hat, wird durch solche bildungsbürgerlich beschränkte Wahrnehmung ignoriert. Selbst wenn - wie üblich - das Meiste nicht wirklich melodiemäßig gut ist (was ja eh eine Krankheit aller Musikrichtungen ist), so bilden seit Jahrzehnten der Blues, oder von der Idee her zumindest, die Jazz- und Country-Musik, oder auch die Cajun- und Zydecko-Musik, die Folk-Musik usw. stetige Zuläufe in die großartige nordamerikanische hochdifferenzierte Musik-Kreativität ab den 50er Jahren. Diese hat dann weiter folgend auf die unfaßbare (nach wie vor dominierende) englische Musikrevolution ab den 60er Jahren entscheidenden Einfluß gehabt. Und schließlich – teilweise vermittelt dadurch - auch auf Deutschland, Österreich und Schweden in den 70er Jahren. Eine eigene Rolle spielen die Italo-Hits der 70er Jahre, die aber leider nur eine Eintags-Fliege waren. Des weiteren auch die genialen Musikstücke der ‘Neuen Deutschen Welle’, Anfang der 80er Jahre, die ebenfalls leider nur Eintags-Fliegen-mäßig drauf war. Zu beachten ist auch die ziemlich wichtige Rolle der Irischen Musik. Seit Neuerem (spätestens ab 2008) kann man ein vorübergehendes Aufflackern in der Türkei und Rußland beobachten. Zwischendurch auch manches kurze Geflackere zwischen 1950 und 1990 in Indien, Japan, Afrika, Südamerika und China. Frankreich hatte in den 50er und 60er Jahren als Chanson-Land einen besonderen Ruf (insbesondere beispielsweise Edith Piaf), ist aber - wenn auch vielleicht nicht mehr so stark – weiterhin immer noch stetig dabei. Man denke nur an „Je t'aime“ (1969) oder an Jean Michel Jarre (ab 1977), an die Griechin Nana Mouskouri, die immer auch gerne auf Französisch singt, Richard Clayderman und etliche Andere.
(Siehe zu dem Thema des weiteren: Professor Heisenberg 1969 zur Jugend- und Studentenbewegung, und speziell deren Musik. Vortrag im Rahmen eines Symposions der Karajan-Stiftung in Salzburg.)
|
|